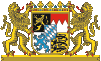Eutersignale: Was riecht da so süßlich-faulig?
Beim Melken der Kühe im Melkstand ist man immer nah am Euter dran. Diesen Vorteil gilt es mit Blick auf Zitzenverletzungen und Euterverletzungen und -erkrankungen unbedingt regelmäßig zu nutzen. Wenn es plötzlich sehr unangenehm süßlich-faulig riecht, schrillen die Alarmglocken. Meist weisen die Tiere an den Eutern dann bereits sichtbare Veränderungen in Form von mehr oder weniger tiefen, bis hin zu blutenden Wunden auf. Hierzulande wird die Krankheit, die sich aktuell immer mehr ausbreitet, als Euterspaltendermatitis bezeichnet. Von den Hautveränderungen und Wunden betroffen ist vor allem der Übergang von der Bauchdecke zu den Vordervierteln und der Bereich des Zentralbandes zwischen diesen. Die Viertel selbst sind nicht betroffen. Die Wunden verursachen Schmerzen beim Tier und lösen die typischen Schmerz- und Abwehrreaktionen bei der Berührung aus. Leider sind die Ursachen und auch eine zielführende Behandlung noch wenig wissenschaftlich beleuchtet.
Als Risikofaktoren gelten laut Beobachtungen eine hohe Milchleistung, die Rasse und Laktationsnummer.
Auch Treponemen, die Erreger von Mortellaro wurden nachgewiesen und spielen offenbar eine nicht unbedeutende Rolle. Aus diesem Grund wird auch häufig von „Mortellaro im Euterkreuz“ gesprochen. Unzureichende Haltungsbedingungen wie z.B. zu kurze Liegeboxen, ältere und unhygienische Liegeboxenmatten und ein vermehrtes Vorkommen von Klauenerkrankungen in der Herde erhöhen ebenfalls das Risiko für diese Erkrankung. Betroffene Tiere weisen oft ein tiefes Zentralband und großvolumige Vorderviertel auf. In der Folge reiben die Euterviertel aneinander und die Haut scheint regelrecht zu bersten. Das wird bei einer hohen Milchleistung noch verstärkt. Ebenfalls förderlich für das Auftreten einer ¬Läsion an dieser Stelle ist eine deutliche Falte vorne zwischen Euter und Bauchdecke. Betroffene wissen es, die Erkrankung ist sehr langwierig und schwerwiegende Verlaufsformen scheinen nahezu irreparabel zu sein.
Ein tägliches Waschen mit desinfizierender Seife (Jodseife) oder unparfümiertem (Baby-) Shampoo, gefolgt von einem effektiven Trocknen mit Föhn oder Baumwolltuch und anschließendem Einreiben und Desinfizieren ist ein erster Behandlungsansatz. Relativ gut bewährt hat sich auch der Einsatz von hypochloriger Säure, die jeder Säugetierorganismus zur Stärkung des Immunsystems produziert. Da die Erkrankung wahrscheinlich multifaktoriell, wie eine Zahnfleischentzündung einzustufen ist, bei der verschiedene Bakterien die Flora kaputtmachen, ist es nicht verkehrt, das Management der Lauf- und Liegeflächen zu überdenken und für mehr Hygiene zu sorgen. Denn irgendein Tropfen bringt bekanntlich das Fass zum Überlaufen. Es sind Mortellaro-Erreger, die am Euter u.a. nachgewiesen wurden. Die Verbindung zwischen Klaue und Euter ist damit eindeutig da.